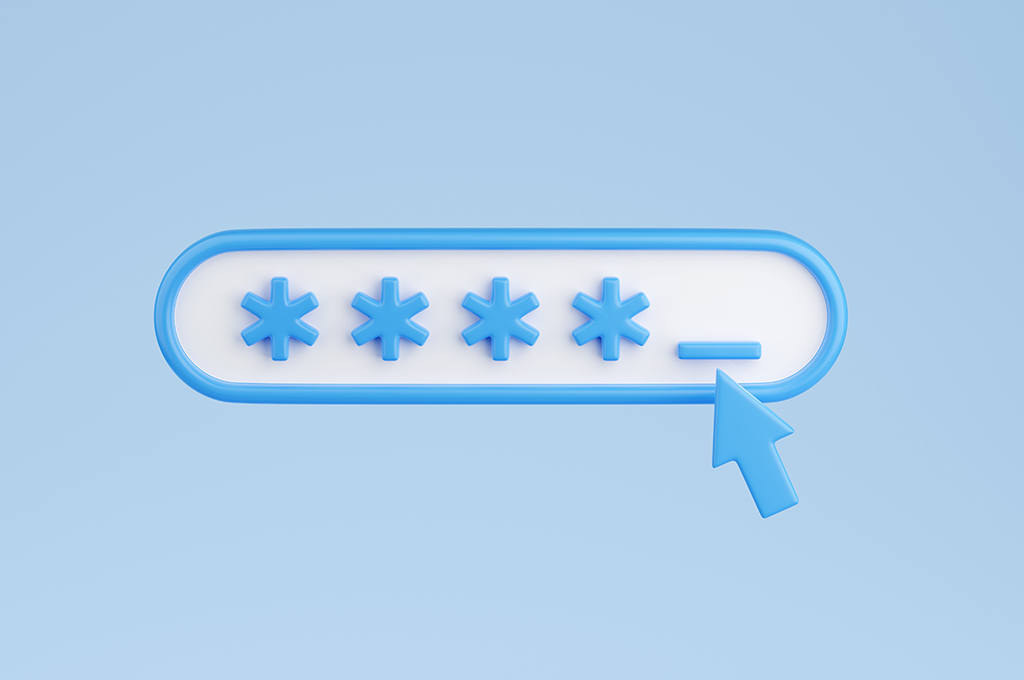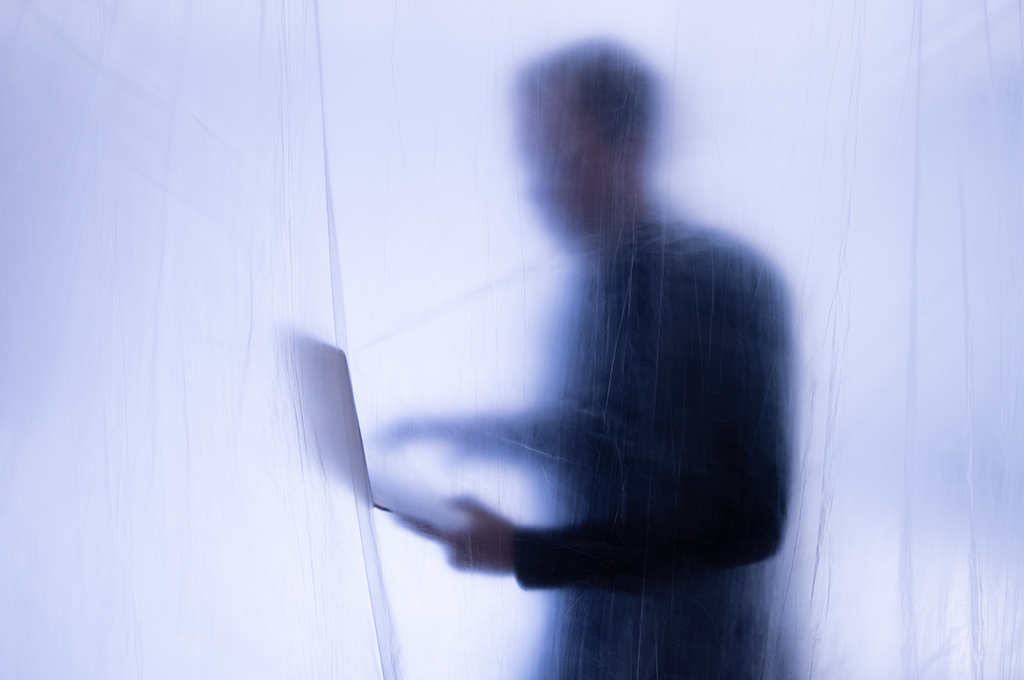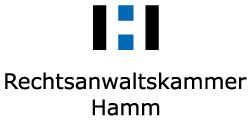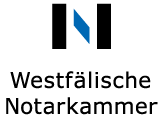Rechtsanwältin Julia von Seltmann, BRAK, Berlin
Seit dem 1.1.2022 dürfen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Schriftsätze, Anträge und Erklärungen den Gerichten nur noch in elektronischer Form übermitteln. Störungen der dafür erforderlichen Infrastruktur treten immer wieder auf. Fristabläufe drohen. Der folgende Beitrag soll unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung und der aktuellen Rechtsprechung Hinweise geben, wie zu verfahren ist, wenn die Justiz aus technischen Gründen nicht auf elektronischem Wege erreichbar ist.
Rechtliche Grundlagen
Der Gesetzgeber hat in den Verfahrensordnungen in der seit dem 1.1.2022 jeweils geltenden Fassung festgelegt, dass eine Einreichung von Schriftsätzen, Anträgen und Erklärungen im Falle einer vorübergehenden Unmöglichkeit der elektronischen Einreichung aus technischen Gründen nach den allgemeinen Vorschriften zulässig bleibt.
Diese Möglichkeit zur Ersatzeinreichung ist von einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abzugrenzen. Die Ersatzeinreichung dient der Fristwahrung. Ist die Frist bereits verstrichen, kommt eine Ersatzeinreichung nicht mehr in Betracht. Dann ist ein Wiedereinsetzungsantrag zu stellen.
Tipp:
Prüfen Sie die Voraussetzungen und Erfolgsaussichten der Ersatzeinreichung in jedem Einzelfall ganz genau und stellen Sie ggf. hilfsweise einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
Voraussetzungen der Ersatzeinreichung
Die Möglichkeit der Ersatzeinreichung besteht nur in Fällen einer vorübergehenden Unmöglichkeit der elektronischen Einreichung. Die professionellen Einreicher sind dadurch nicht von der Notwendigkeit entbunden, die erforderlichen technischen Einrichtungen für die Einreichung elektronischer Dokumente vorzuhalten und bei technischen Ausfällen unverzüglich für Abhilfe zu sorgen (vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 17/12634, 28). Das OVG Münster (Beschl. v. 6.7.2022 – 16 B 413/22) entschied, dass eine Internetstörung über einen Zeitraum von fünf Wochen nicht mehr vorübergehend sei und der Rechtsanwalt ggf. einen Internet-Hotspot hätte einrichten müssen.
Die elektronische Einreichung muss aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich sein. Dabei spielt es nach dem Willen des Gesetzgebers keine Rolle, ob die Ursache für die vorübergehende technische Unmöglichkeit in der Sphäre des Gerichts oder in der Sphäre des Einreichenden zu suchen ist (BT-Drs. 17/12634, 27).
Technische Gründe i. S. d. § 130d S. 2 ZPO liegen nur bei einer Störung der für die Übermittlung erforderlichen technischen Einrichtungen vor, nicht dagegen bei in der Person des Einreichers liegenden Gründen (BGH, Beschl. v. 25.1.2023 – IV ZB 7/22). Der Beschwerdeführer hatte vorgetragen, dass er aufgrund einer Erkrankung am Urlaubsort und dort fehlender technischer Ausstattung nicht in der Lage gewesen sei, die Berufungsbegründung als elektronisches Dokument zu übermitteln. Dies ließ der BGH nicht ausreichen. Bereits der Wortlaut des § 130d S. 2 ZPO spreche dagegen, in Fallgestaltungen, in denen die technischen Einrichtungen zur Übermittlung eines Schriftsatzes als elektronisches Dokument funktionsfähig vorhanden seien und dem Einreichenden lediglich der tatsächliche Zugriff darauf versperrt sei, von einer vorübergehenden Unmöglichkeit zur Übermittlung aus „technischen Gründen“ auszugehen.
Störungen können auch in der Sphäre der Justiz auftreten und dazu führen, dass die Einreichung technisch unmöglich ist. Sie sind insbesondere daran zu erkennen, dass Fehlermeldungen bei der Adressierung der Gerichte auftreten oder die Nachricht nicht erfolgreich gesendet werden konnte.
Tipp:
Prüfen Sie immer, ob Ihre Nachricht erfolgreich versandt wurde! Die Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen an die Prüfung der erfolgreichen Nachrichtenübermittlung.
Unverzügliche Glaubhaftmachung
Die technische Unmöglichkeit der Übermittlung einschließlich ihrer vorübergehenden Natur ist unverzüglich glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung sollte möglichst gleichzeitig mit der Ersatzeinreichung erfolgen. Jedoch sind Situationen denkbar, in denen der Rechtsanwalt erst kurz vor Fristablauf feststellt, dass eine elektronische Einreichung nicht möglich ist und bis zum Fristablauf keine Zeit mehr verbleibt, die Unmöglichkeit darzutun und glaubhaft zu machen. In diesem Fall ist die Glaubhaftmachung unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, nachzuholen (BT-Drs. 17/12634, 28).
Darauf, dass Gerichte Milde walten lassen, sollte man sich indes nicht verlassen. Denn der BGH wies darauf hin, dass ein Gericht nicht gehalten sei, die Vorschrift des § 130d S. 3 Hs. 1 ZPO nach ihrem Inkrafttreten während einer (weiteren) Übergangsfrist nicht oder nur „behutsam“ anzuwenden (BGH, Beschl. v. 15.12.2022 – III ZB 18/22).
Der Rechtsbegriff „unverzüglich“ in § 130d S. 3 ZPO ist im Sinne der in § 121 I 1 BGB enthaltenen Legaldefinition als „ohne schuldhaftes Zögern“ auszulegen (BGH, Beschl. v. 15.12.2022 – III ZB 18/22). Die Glaubhaftmachung muss zeitlich unmittelbar erfolgen. Anders als bei § 121 BGB sei der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt keine gesonderte Prüfungs- und Überlegungszeit zu gewähren, sondern die Glaubhaftmachung habe zu erfolgen, sobald Kenntnis vom Scheitern der Einreichung aus technischen Gründen bestehe und die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt zu einer geschlossenen Schilderung der tatsächlichen Abläufe oder Umstände in der Lage sei (BGH, Beschl. v. 26.1.2023 – V ZB 11/22).
Ist es bereits im Zeitpunkt der Ersatzeinreichung eines Schriftsatzes möglich, die vorübergehende technische Unmöglichkeit der elektronischen Übermittlung darzulegen und glaubhaft zu machen, hat dies mit der Ersatzeinreichung zu erfolgen. In diesem Fall genügt es nicht, wenn die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt die Voraussetzungen für eine Ersatzeinreichung nachträglich darlegt und glaubhaft macht (BGH, Beschl. v. 17.11.2022 – IX ZB 17/22).
Tipp:
Meist gibt es bereits bei der fehlgeschlagenen elektronischen Übermittlung Hinweise darauf, dass die elektronische Einreichung nicht erfolgreich war. Diese Hinweise sollten mit der Ersatzeinreichung für die Darlegung und Glaubhaftmachung genutzt werden. Gegebenenfalls können später noch Konkretisierungen erfolgen, die man sich vorbehalten sollte.
Für den Fall einer fehlgeschlagenen Adresssuche hatte das LAG Schleswig-Holstein entschieden, dass ein konkreter Vortrag erforderlich sei, warum kein Bedienfehler vorliege (LAG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 8.4.2021 – 1 Sa 358/20).
Zulässige Mittel der Glaubhaftmachung sind alle präsenten Beweismittel i. S. v. §§ 355 bis 455 ZPO, die Versicherung an Eides statt, die anwaltliche Versicherung, schriftliche Erklärung von Zeugen, Privatgutachten, Auswertungen der Metadaten, Screenshots oder Fotos (dazu von Seltmann, BRAK-Magazin 6/2021, 12 f.).
Rechtsfolge der vorübergehenden technischen Unmöglichkeit
Liegt eine vorübergehende technische Unmöglichkeit vor, ist die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften ausnahmsweise zulässig. Zulässig sind insbesondere die Übermittlung per Post, das Einlegen in den (Nacht-)Briefkasten des Gerichts oder ein Telefax. Auf Anforderung des Gerichts ist die Einreichung in elektronischer Form nachzuholen.
Rechtsgrundlage der Ersatzeinreichung
§ 130d ZPO – Nutzungspflicht für Rechtsanwälte und Behörden
1Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument zu übermitteln. 2Ist dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig. 3Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen.
Entsprechende Regelungen in den anderen Verfahrensordnungen:
§ 14b FamFG, § 46g ArbGG, § 65d SGG, § 55d VwGO, § 52d FGO, § 32d StPO, § 110c OWiG
Bildnachweis: stock.adobe.com | MP Studio