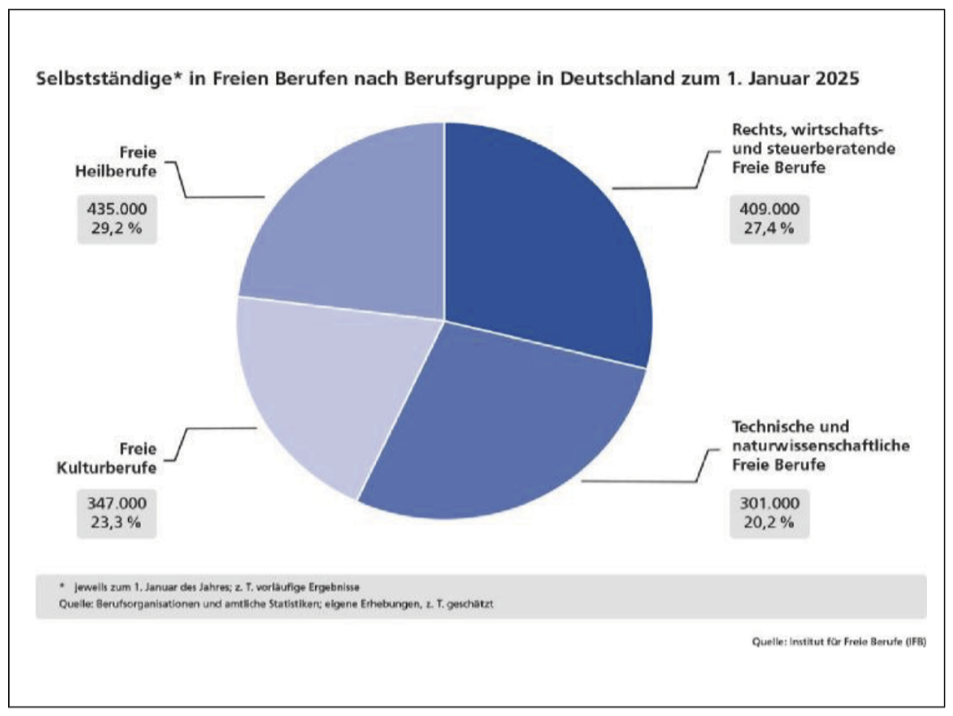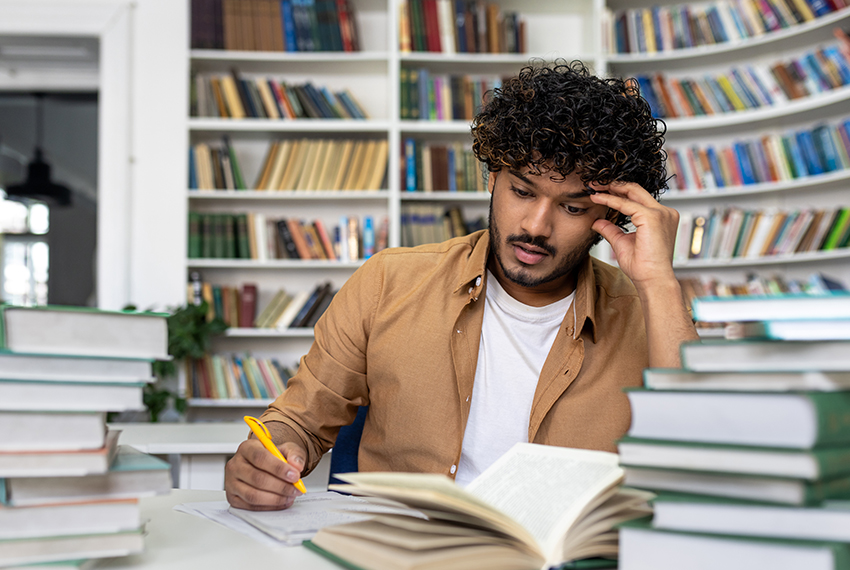Zwischen Februar und September 2024 beteiligten sich 1.835 Personen an der sechsten bundesweiten Absolvent:innenbefragung des Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. (BRF). Ziel der Erhebung war es, ein aktuelles Stimmungsbild unter den (ehemaligen) Jurastudierenden zu gewinnen und Reformbedarfe der juristischen Ausbildung aus Studierendensicht aufzuzeigen. Die Ergebnisse, veröffentlicht im Oktober 2025, verdeutlichen erhebliche Frustrationen mit Struktur und Prüfungsbelastung des Studiums, zugleich aber auch konkrete Erwartungen an Modernisierung und Reformen.
Die Umfrage zeigt, dass zwei Drittel der Befragten (66,27 %) das Jurastudium in seiner jetzigen Form nicht weiterempfehlen würden – ein massiver Anstieg gegenüber 43,93 % im Jahr 2022. Nur rund ein Drittel (32,04 %) würde das Studium uneingeschränkt oder eingeschränkt empfehlen, wobei lediglich 5,12 % dies „aus voller Überzeugung“ tun. Als Hauptgründe nannten die Teilnehmenden den extremen psychischen Druck während der Examensvorbereitung, die Überforderung durch den einphasigen Prüfungsaufbau und das Fehlen eines berufsqualifizierenden Abschlusses bei Nichtbestehen. Viele berichteten von psychischen Belastungen bis hin zu Angststörungen oder Depressionen. Gleichzeitig äußerten sie ein hohes inhaltliches Interesse am Fach und an juristischen Methoden, forderten jedoch eine strukturelle Reform der Ausbildung, etwa durch einen integrierten Bachelor, gestufte Prüfungen oder bessere psychologische und didaktische Begleitung.
Auch die Bewertung der Examensklausuren fiel deutlich kritisch aus. 81,63 % der Befragten bezweifeln die Objektivität juristischer Prüfungen und kritisieren insbesondere die fehlende verdeckte Zweitkorrektur. Viele monieren eine stark subjektive und intransparente Notenpraxis, die durch formale Anhängigkeit an Erstbewertungen verschärft werde.
Gleichzeitig spricht sich eine klare Mehrheit für eine Modernisierung der Lehrformate aus. 82,02 % wünschen sich hybride Angebote aus Präsenz- und Online-Lehre, 56,08 % sogar vollständig digitale Veranstaltungen. Diese Erfahrungen aus der Coronazeit hätten sich als effizient und lernförderlich erwiesen.
Hinsichtlich der Internationalität zeigt die Studie weiterhin Nachholbedarf: Nur 25 % der befragten Absolvent:innen absolvierten während des Studiums einen Auslandsaufenthalt, obwohl 94,68 % dieser Gruppe diesen Schritt uneingeschränkt empfehlen. 40 % aller Befragten halten Auslandserfahrungen für wichtig, bemängeln jedoch fehlende Anerkennungs- und Finanzierungsmöglichkeiten.
Das traditionelle Konzept des „Einheitsjuristen“ erfährt zunehmend Skepsis. Während 90,57 % das Einheitsmodell bis zur Zwischenprüfung befürworten, sinkt die Zustimmung mit Fortdauer des Studiums: Nur noch 45,56 % unterstützen es bis zur zweiten Staatsprüfung, während 46,16 % es ablehnen. Parallel dazu befürworten 85,83 % der Teilnehmenden die Einführung eines integrierten Bachelorabschlusses, um den hohen Prüfungsdruck zu mindern, wobei 91,01 % zugleich angeben, sich auch mit einem solchen Zwischenabschluss weiter auf die Staatsexamina vorzubereiten.
Der juristische Vorbereitungsdienst gilt für die meisten Befragten als größere Herausforderung als das Studium selbst (49,64 % Zustimmung), wird jedoch zugleich als sinnvoller Bestandteil der zweistufigen Ausbildung bewertet: 63,95 % sehen in dieser Struktur einen Mehrwert, 89,97 % planen den Referendardienst in ihrer weiteren Laufbahn fest ein.
Weiterführende Links:
Sechste Absolvent:innenbefragung 2025
Informationen zum BRF