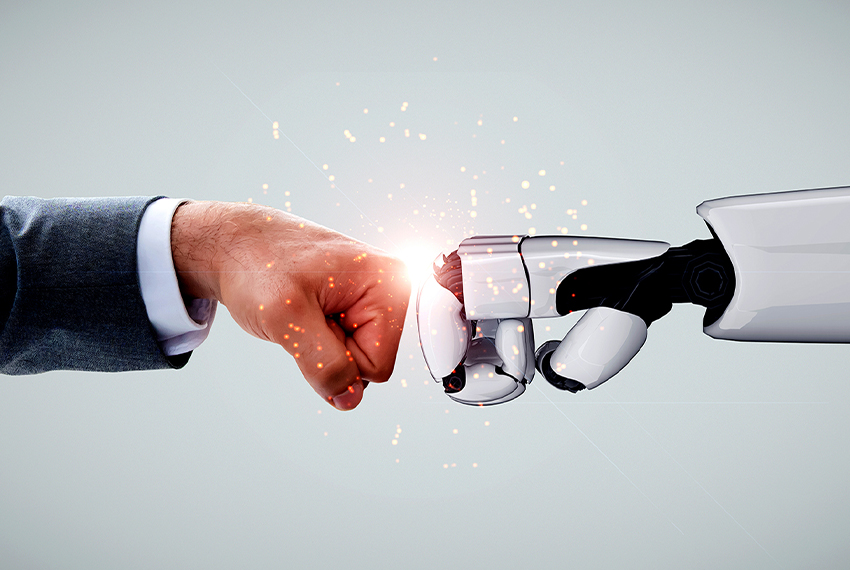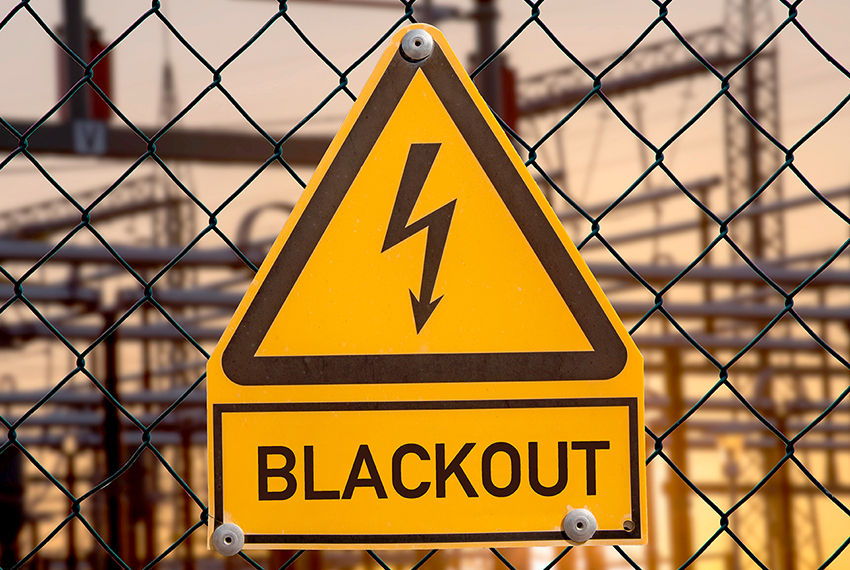Die von der BRAK herausgegebene Mitgliederstatistik zum 1.1.2025 zeigt erneut einen leichten Rückgang bei den niedergelassenen Anwältinnen und Anwälten, die Gesamtzahl über alle Zulassungsarten stieg jedoch leicht. Der Frauenanteil in der Anwaltschaft stiegt erneut auf nunmehr 37,33 %.
Die 28 Rechtsanwaltskammern verzeichneten zum Stichtag 1.1.2025 insgesamt 172.084 Mitglieder. Gegenüber dem Vorjahr (172.514) bedeutet dies insgesamt einen leichten Rückgang um 430 Mitglieder (-0,25 %). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf 82,27 % weniger nichtanwaltliche Mitglieder von Geschäftsführungs- und Aufsichtsorganen von Berufsausübungsgesellschaften (BAG) nach § 60 II Nr. 3 BRAO zurückzuführen.
Zwar ist die Gesamtzahl der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in allen Zulassungsarten bundesweit um 0,44 % gestiegen (1.1.2025: 166.504; Vorjahr: 165.776). Dennoch ist die Anzahl der Rechtsanwälte in Einzelzulassung zum 1.1.2025 erneut deutlich zurückgegangen – diese machen mit 83,31 % den größten Anteil an den natürlichen Mitgliedern der Rechtsanwaltskammern aus. Zum Stichtag waren es 138.715 und damit 874 weniger als im Vorjahr (139.589; -0,63 %). Die Entwicklung der Einzelzulassungen, die seit dem Jahr 2017 einen kontinuierlichen Abwärtstrend aufweisen, zeigt somit eine anhaltend negative Tendenz. Dennoch stieg ihr weiblicher Anteil um 0,07 % von 48.542 auf 48.575 Rechtsanwältinnen.
Ein Plus von 823 Mitgliedern (4,25 %) verzeichneten die doppelt Zugelassenen (1.1.2025: 20.204; Vorjahr: 19.381), davon 9.356 Frauen (Vorjahr: 8.907; +5,04 %). Am meisten legten die Syndikusrechtsanwältinnen und -rechtsanwälte mit 11,45 % zu: 7.585 Syndici waren zum 1.1.2025 zugelassen, 779 mehr als im Vorjahr (6.806). Der Trend zu dieser Zulassungsart hält damit an – ebenso die Beliebtheit bei Frauen: Der weibliche Anteil lag bei 60,42 % (Vorjahr 59,39 %). Zum Vergleich: Bei den doppelt Zugelassenen lag der weibliche Anteil bei 46,31 % (Vorjahr: 45,96 %), bei den einzeln Zugelassenen bei 35,02 % (Vorjahr: 34,77 %).
Insgesamt lag der Frauenanteil unter den bundesweit zur Anwaltschaft Zugelassenen (166.504) mit 62.514 Rechtsanwältinnen bei 37,33 % (Vorjahr. 37,09 %). Der
weibliche Mitgliederanteil in allen Zulassungsarten ist um 1,66 % gestiegen (Vorjahr: 1,52 %). Der Aufwärtstrend hält damit an.
Die Anzahl der Berufsausübungsgesellschaften erhöhte sich zum Stichtag um 8,44 % von 4.727 im Vorjahr zu 5.126 zugelassenen Mitgliedern der Rechtsanwaltskammern. Den größten Anteil daran haben die 3.376 PartGmbB (Vorjahr: 3.177), gefolgt von den 1.525 GmbHs (Vorjahr: 1.404). Fast verdreifacht hat sich die Zahl der zugelassenen GmbH & Co. KG (1.1.2025: 61; Vorjahr: 22).
Der kontinuierliche Anstieg der in Deutschland niedergelassenen ausländischen Rechtsanwälte setzt sich fort: Zum 1.1.2025 waren es bundesweit insgesamt 1.380, dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (1.288) einen Zuwachs um 7,14 %. Davon waren insgesamt 716 europäische Rechtsanwälte nach § 2 EuRAG (Vorjahr: 705) und insgesamt 664 ausländische Rechtsanwälte nach § 206 BRAO (Vorjahr: 583) niedergelassen.
Die Anzahl der Fachanwältinnen und Fachanwälte ist ebenfalls weiter gestiegen.
Zum Stichtag gab es 46.800 Fachanwälte (Vorjahr: 46.035; +1,66 %), davon 15.523 Fachanwältinnen (Vorjahr: 15.201; +2,12 %). Damit ist der Frauenanteil bei den Fachanwaltschaften erneut gestiegen und liegt bei 33,17 % (Vorjahr: 33,02 %). Gemessen an der Gesamtzahl der insgesamt zugelassenen Rechtsanwälte sind 28,11 % (Vorjahr: 27,77 %) auch Fachanwälte; von den insgesamt zugelassenen Rechtsanwältinnen sind 24,72 % (Vorjahr: 24,83 %) auch Fachanwältinnen.
Die Anzahl der erworbenen Fachanwaltstitel hat mit insgesamt 58.655 Titeln weiter zugenommen (Vorjahr: 58.474; +0,31 %), insbesondere unter den weiblichen Titelträgern (01.01.2025: 18.608; Vorjahr: 18.344; +1,44 %).
Diese Fachanwaltstitel verteilten sich zum Stichtag wie folgt: 35.404 Rechtsanwälte (davon 12.567 weiblich) erwarben einen Fachanwaltstitel, 10.046 (davon 2.717 weiblich) zwei Fachanwaltstitel und 1.350 (davon 239 weiblich) die höchstmöglichen drei Fachanwaltstitel.
Beliebteste Fachanwaltschaft ist nach wie vor die für Arbeitsrecht (11.314; Vorjahr: 11.163), gefolgt von Familienrecht (8.528; Vorjahr: 8.759) und Steuerrecht (4.641; Vorjahr: 4.695). Die höchsten Zuwächse verzeichneten die Fachanwaltschaften für Vergaberecht (+7,1 %), Migrationsrecht (+6,77 %) und Internationales Wirtschaftsrecht (+6,5 %). Die Fachanwaltschaften für Sozialrecht (-2,88 %), für Familienrecht (-2,64 %) und für Transport- und Speditionsrecht (-1,32 %) hatten die höchsten Rückgänge.